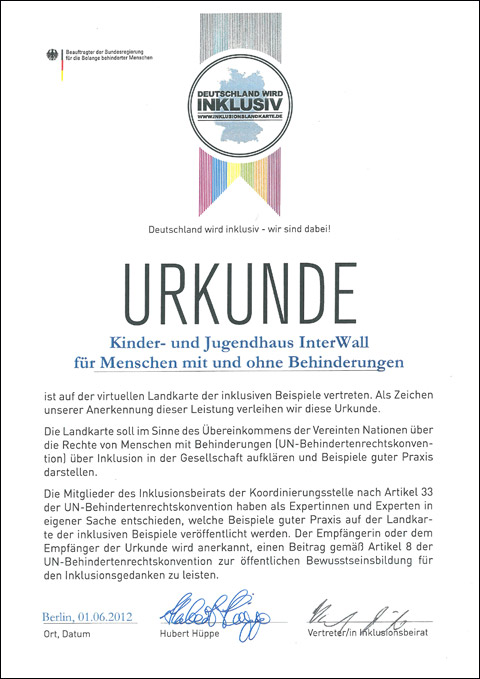INKLUSION
Die Betonung liegt auf dem Weg
Inklusion - eine Gesellschaftsutopie? Inklusion - eine Hoffnung von Eltern und Behindertenverbänden, die ganz nah an Kindern und Jugendlichen mit Behinderung dran sind? Inklusion - eine überhöhte Ideologie, ein Traumgespinst, eine Heilslehre?
Die Pole reichen von Aktionismus bis Skepsis oder gar Ablehnung. Kann es Inklusion für alle geben? Heißt Inklusion wirklich: Alle alles? Ist die Gesellschaft darauf vorbereitet? Sind Pädagogen, Betreuer, Mitbürger an der Basis so vorbereitet, dass es losgehen kann? Will das denn jeder?
Im folgenden Artikel möchte ich, als langjähriger Leiter des Kinder- und Jugendhaus "InterWall" in Dresden Gorbitz, von den Erfahrungen eines Weges berichten, welcher - konzeptionell über den Schwerpunkt Integration - über Jahre hinweg erste Impulse zur Inklusion setzen konnte. Basis allen Denkens und Handelns war, jungen Menschen mit Behinderung Freizeiträume zu erschließen, die Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung selbstverständlich zur Verfügung stehen.
Jugendhilfe definiert sich als Instrument für die Belange von Kindern und Jugendlichen aller Couleur. Dabei finden in den Gesetzestexten junge Menschen mit Behinderungen keine gesonderte Erwähnung. Ist Jugendhilfe damit schon auf einem inklusiven Weg? In manche Kinder- und Jugendeinrichtungen kommen am Nachmittag vermehrt Kids aus Förderschulen für Lernbehinderte. Wendet man die Definition von „Behinderung“ auf diese Zielgruppe an, dann wäre ja alles in Ordnung und man wäre vollkommen inklusiv.
Mancher Sozialpädagoge hält sich gern an diese einfache Lesart. Somit wäre die „Querschnittsaufgabe“ in der Kinder- und Jugendhilfelandschaft erfüllt, die jedem Träger durch einen Zuwendungsbescheid auferlegt ist.
Was aber ist mit den jungen Menschen mit Behinderung, die weniger ins Muster passen? Was ist mit denen, die auffallen und sichtbar anders sind oder sich sichtbar anders verhalten? Wie können die in ein Kinder- und Jugend-(Freizeit)-Haus eingebunden werden? Vorausgesetzt sei: sie wollen das. Was ist mit denen, die tatsächlich auf Assistenzen zur Realisierung ihrer Freizeit oder körperlicher Bedürfnisse angewiesen sind? Wir reden von jungen Menschen, die nicht einfach die Tür aufmachen können und sagen: Hallo, hier bin ich!
Diese und andere Fragen sind zu bewegen. Ein Aufsatz hilft nur ein Stück des Weges darzustellen. Die Facetten sind vielfältig. Was im Folgenden beschrieben werden kann, ist der kleinschrittige und lange Weg eines Kinder- und Jugendhauses, welches sich seit mehr als 18 Jahren dem Anspruch stellt, ein zunächst integratives und in der Folge ein inklusiveres Miteinander zu ermöglichen.
Vorab: Inklusion ist eine innere Haltung. Gesetzlich sind Forderungen aufgestellt zur Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention. Politisch gesehen ist dies eine Willenserklärung von „oben“. Und es ist vor allem eine Willenserklärung von Betroffenen. Inklusion braucht einen breiten Konsens und einen allgemeinen Willen sowie verschiedene materielle Voraussetzungen zur Umsetzung. Es bedarf der Bereitschaft zum Verstehen wollen und die Offenheit eines jeden Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung so in den Blick zu bekommen, dass sie keine Exoten sind. Inklusion heißt, sich daran zu „gewöhnen“, dass Menschen mit Beeinträchtigung eigen sind und „normal“ in den Alltag gehören.
Aber trifft es das schon? Ist damit alles gesagt und getan? Ist die Lebenswirklichkeit in vielen Bereichen schon so bereit, dass Inklusion ohne Schwierigkeiten umgesetzt werden kann?
Die Diskussion wird kontrovers geführt. So warnt der Leiter des Institutes für Rehabilitationswissenschaften an der Humboldt Universität Berlin, Abteilung Verhaltensgestörtenpädagogik, Bernd Ahrbeck davor, „…Unmögliches von der Inklusion zu erwarten. Zum Beispiel, dass aus der Gemeinsamkeit in der Schule eine spätere Gemeinsamkeit im Leben folge. Das ist illusorisch. Das Erwachsenenleben ist nicht inklusiv. Entwickelte Gesellschaften sind hochgradig gespalten. [Die Zeit N13, 21. März 2013, Seite 18 / auch zeit- online, 29. März 2013]
Verwiesen sei auf den kürzlich erschienen Artikel in der Lebenshilfezeitung 03/2014 von Gabriele Kost aus Bonn. Hier schreibt die Autorin im ersten Satz: „Nein unsere Gesellschaft ist noch nicht reif für Inklusion!“ Und sie begründet ausführlich, was sie erlebt und meint, was Inklusion be- und verhindert. Da wird gewarnt vor Aktionismus und aller Orten wahrgenommenem „Inklusionsgehabe“. „Kein Zusammenkommen von Professionellen ohne einen Beitrag zur Inklusion, keine Zielplanung 2014 ohne Inklusion, dabei ist der Begriff weder präzise noch evaluierbar noch wirklich aussagekräftig.“
Zweifel sind angesagt. Handlungsbedarf ist erkennbar. Zeit muss eingeräumt werden, damit eine Frucht aus einem Samen wachsen kann. Ich kann mich neben den Blumentopf stellen und lege ein Korn in die Erde. Ich kann dem Samen gut zureden (und geredet wird viel über Inklusion). Ich kann permanent die Gießkanne schwenken. Ich kann gießen und düngen. Schneller wachsen wird das Pflänzchen dennoch nicht. Möglicherweise ertrinkt das Korn, weil da zu viel Wasser war. Oder die Pflanze verbrennt an zu viel Dünger. Heißt? Alles braucht und hat seine Zeit.
So haben wir es mit der Integration im „InterWall“ gemacht. Wir haben über Jahre hinweg eingeladen, beworben und Versuche der Begegnung initiiert. Das tun wir heute noch. Wir entwickelten als Türöffner ganz spezielle Angebote für Menschen mit Behinderung und setzten sie auf unser Programm. Kurse luden junge Menschen mit Behinderung ein, dass sie sich aus Gewohntem hinaus oder zu uns herein wagen; dass die Betreuenden Mut haben, die ihnen Anvertrauten loszulassen in einen unbekannten und vorurteilsbelasteten Raum. (Oder wer kennt sie nicht, die Vorurteile gegen Jugendliche und Jugendhäuser? Da lernt man doch wohl … Ja, was denn?)
Bevor es mit so einem Kurs losgehen sollte, waren alle beisammen im offenen Treff. Am Anfang für Minuten, später für Stunden. Da wird man schon beäugt und abgecheckt. Geben und Nehmen.
Einige brauchen keinen Kurs als mehr, sie kamen/ kommen so, entdecken den Raum, das Haus für sich und den Sport, Musik oder Spiele, welche Grenzen verwischen. Jugendliche mussten es aushalten, dass sich hier junge Menschen tummeln, die sich anders geben, die anders ticken. Sondierung und Annäherung als Vorstufe des Begegnens, der Kommunikation und erster Normalität.
Wir haben herbe Rückschläge erlitten. „Unsere Behinderten brauchen Ihr Haus nicht, die haben ihre sozialen Kontakte“, wurde uns gesagt.
„Kann denn da meinem Kind nichts passieren?“ fragten Eltern voller Zweifel. „Werden die denn Freunde finden?“ hieß eine Sehnsucht.
Andere hatten Courage und ließen ihr Kind entscheiden oder entschieden sich dafür, nach außen zu gehen.
So hat sich im Laufe der Jahre aus Integration als konzeptionelle Aufgabe das Pflänzchen Inklusion entwickelt. Am Anfang sprachen wir von „Zumutung“. Das Wort ist meist negativ besetzt. Versucht man es positiv zu deuten heißt es: Mut fassen, sich etwas zumuten oder dem anderen etwas zutrauen. Das mündet in Vertrauen, dass ein Gelingen impliziert.
Es ist zu einer Normalität geworden, dass im Haus Menschen mit Behinderung anzutreffen sind. Darüber wird kein großes Wesen gemacht. Jugendliche wissen, was anders im „IW“ (Spitzname für „InterWall“) ist. Inklusives Miteinander ist Realität.
Manche Kids sind fortgeblieben, wollen nichts mit „denen“ zu tun haben. Gerade das Jugendalter hat separierende Tendenzen. Manche junge Menschen mit Behinderung sind weggeblieben. Es war ihnen zu laut, zu turbulent oder was auch immer. Selbst so eine Aussage: „Ich will doch nicht mit denen in einen Topf geworfen werden.“ gehört dazu.
Andere Kids haben dafür den Fuß ins Haus gesetzt. Letzten Endes ist es wie im wahren Leben: man kann miteinander und/ oder man kann nicht miteinander. Das muss sich finden. Für den einen fallen gewohnte Schonräume weg, für den anderen ist es ungewohnt, Raum zu teilen, den sie für sich okkupiert haben wollen.
Darum bleibt die konstante Begleitung durch Sozialpädagogen sinnvoll, weil sich mit den Generationswechseln im Haus die Kommunikation und die Annäherung des Miteinanders wiederholt. Es sind 18 Jahre vergangen. Das sind wie viele Generationen?
Inklusion meint in der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein sukzessives aufeinander Zustreben und ein Kennenlernen. Inklusion meint ein Einüben von anderen Formen der Verständigung und die Rücksichtnahme oder gegenseitig wertschätzende Achtung. Inklusion kann nur als Weg verstanden werden, nicht als Order oder Auflage: Jetzt machen das alle mal. Dann sind wir sehr schnell bei einem Aktionismus, der eher Schaden anrichtet und ohne Langzeitwirkung bleibt.
Mein Kind besuchte einen Kindergarten mit Integrationskindern. Befragt, was ich denn da gerade tue, sprach ich, ich schriebe über Inklusion. Er – inzwischen 17 Jahre alt – wollte wissen, was das denn sei? Ich versuchte es ihm zu erklären.
„Du wirst in einer Gruppe, in der es unter anderem ein Mädchen gab, welches nicht hören und nicht sprechen konnte… Man spricht hier von einem Menschen mit Behinderung oder mit einer Beeinträchtigung, welche die Teilnahme an verschiedenen Bereichen des Lebens erschwert. Inklusion heißt also, dass diese Menschen ganz normal unter uns leben, dass also das, was behindert oder beeinträchtigt, nicht die Rolle spielt.“
„Ach so, ja klar. Ich hab keine Probleme mit Behinderten. Und darüber muss man was schreiben?“
Inklusion ist ein Lernprozess, der sich im Aufwachsen vollzieht, ein Stück im Hineinwachsen. Am besten ist es, wenn das Begegnen und Lernen im Kindesalter beginnt.
Es sollte keine Rolle mehr spielen, dass jemand im Rollstuhl sitzt, sehbehindert ist oder mit dem Lernen etwas langsamer vorankommt. Äußere und innere Rahmenbedingungen des schulischen oder des sozialen Lernortes sind so gestaltet, dass sie alle dabei sein können. Gleichmacherei also? Den Ruch dessen hat es sicher. Nicht immer will und kann jeder mit jedem zusammen sein und muss es auch nicht. Das wird so bleiben. Gleichwohl geht es um den Weg, der am Ende die Realität einer weitestgehend barrierefreien gesellschaftlichen Umwelt schafft. Die Betonung liegt auf dem Weg.
(Uwe Teich – Leiter des Kinder- und Jugendhaus "InterWall")